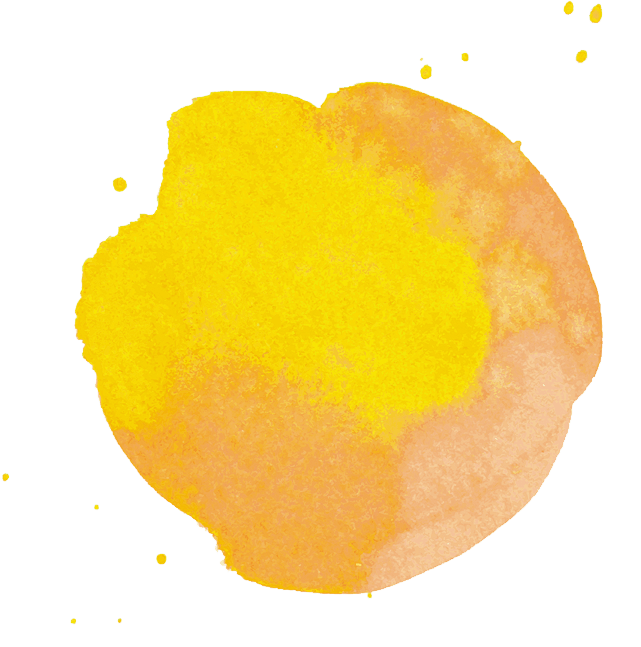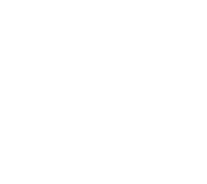Diese Website begleitet Sie auf Ihrem Weg mit der CLL. Sie bietet Hilfe für Betroffene und Angehörige in allen Phasen der Erkrankung: von den ersten Schritten nach der Diagnose über ausführliche Informationen zum Krankheitsbild und mögliche Therapien bis hin zum Alltag mit CLL.

Eine CLL-Diagnose wirft viele Fragen auf
Jedes Jahr erhalten in Deutschland rund 5.600 Menschen die Diagnose chronische lymphatische Leukämie, abgekürzt CLL. Insbesondere der darin enthaltene Begriff Leukämie (Blutkrebs) wirkt zunächst einmal schockierend, weckt Ängste und wirft viele Fragen auf.
Diese Website will Betroffene und Angehörige in dieser Phase abholen und begleiten. Sie soll aufklären, verständlich über die Krankheit sowie mögliche Behandlungen informieren und Anregungen zum Umgang mit der CLL geben. Auf diese Weise möchten wir Ihnen helfen, Antworten auf die dringende Frage zu finden, wie das Leben nun mit der Diagnose weitergeht.
Denn was viele nicht wissen: Zwar ist die CLL eine chronische Erkrankung und bisher nicht heilbar, aber dank des medizinischen Fortschritts kann die Krankheit heute auch in fortgeschrittenen Stadien oft gut kontrolliert werden. Eine CLL muss daher nicht mit einer verkürzten Lebenserwartung oder geringerer Lebensqualität einhergehen.

Was ist eine CLL?
Leukämie ist nicht gleich Leukämie. Bei dem Wort Leukämie, zu Deutsch Blutkrebs, denken viele Menschen zunächst an akute Verläufe, die innerhalb weniger Wochen lebensbedrohlich werden können. Eine solche Art der Leukämie ist die CLL jedoch in der Regel nicht. Die chronische lymphatische Leukämie schreitet meist nur langsam fort, wodurch viele Erkrankte oft eine lange Zeit keine Symptome aufweisen und nicht umgehend behandelt werden müssen.
Wie bei jeder Erkrankung können sich jedoch der Verlauf, die Symptome oder die zugrunde liegende Genetik bei Patientinnen und Patienten individuell unterscheiden.
Diagnose

Eine CLL-Diagnose wirft viele Fragen auf
Jedes Jahr erhalten in Deutschland rund 5.600 Menschen die Diagnose chronische lymphatische Leukämie, abgekürzt CLL. Insbesondere der darin enthaltene Begriff Leukämie (Blutkrebs) wirkt zunächst einmal schockierend, weckt Ängste und wirft viele Fragen auf.
Diese Website will Betroffene und Angehörige in dieser Phase abholen und begleiten. Sie soll aufklären, verständlich über die Krankheit sowie mögliche Behandlungen informieren und Anregungen zum Umgang mit der CLL geben. Auf diese Weise möchten wir Ihnen helfen, Antworten auf die dringende Frage zu finden, wie das Leben nun mit der Diagnose weitergeht.
Denn was viele nicht wissen: Zwar ist die CLL eine chronische Erkrankung und bisher nicht heilbar, aber dank des medizinischen Fortschritts kann die Krankheit heute auch in fortgeschrittenen Stadien oft gut kontrolliert werden. Eine CLL muss daher nicht mit einer verkürzten Lebenserwartung oder geringerer Lebensqualität einhergehen.
Krankheitsbild

Was ist eine CLL?
Leukämie ist nicht gleich Leukämie. Bei dem Wort Leukämie, zu Deutsch Blutkrebs, denken viele Menschen zunächst an akute Verläufe, die innerhalb weniger Wochen lebensbedrohlich werden können. Eine solche Art der Leukämie ist die CLL jedoch in der Regel nicht. Die chronische lymphatische Leukämie schreitet meist nur langsam fort, wodurch viele Erkrankte oft eine lange Zeit keine Symptome aufweisen und nicht umgehend behandelt werden müssen.
Wie bei jeder Erkrankung können sich jedoch der Verlauf, die Symptome oder die zugrunde liegende Genetik bei Patientinnen und Patienten individuell unterscheiden.
Kennzeichen der CLL:
unkontrollierte
Zellvermehrung im Blut
Die Gefahr für den Organismus geht bei der CLL von einer Gruppe der weißen Blutkörperchen aus. Betroffen sind sogenannte B-Zellen (B-Lymphozyten), die sich krankhaft verändern. Diese nur noch eingeschränkt funktionsfähigen Zellen können sich unkontrolliert vermehren und so andere Blutzellen verdrängen.
Behandlung
Welche Behandlung ist die richtige?
Die Krebsmedizin hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, gerade auch auf dem Feld der chronischen lymphatischen Leukämie. Doch nicht jede Behandlung ist für jeden Menschen mit CLL geeignet. Entscheidende Kriterien sind unter anderem die individuelle Verfassung der Betroffenen, eventuelle Vorerkrankungen, bereits durchgeführte Behandlungen und das jeweilige Stadium der CLL.
Für Sie als Patientin oder Patient kommt es daher darauf an, im vertrauensvollen Gespräch zusammen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt zu klären, ob eine Behandlung bereits notwendig ist oder ob die Krankheit zunächst lediglich engmaschig beobachtet werden sollte (die sogenannte „Watch and wait“-Phase“).
Wenn der Beginn einer Therapie aus ärztlicher Sicht nötig ist, ist es für Sie entscheidend, eine Therapie zu finden, die bestmöglich auf Sie und Ihre CLL-Erkrankung zugeschnitten ist.
Behandlung

Welche Behandlung ist die richtige?
Die Krebsmedizin hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, gerade auch auf dem Feld der chronischen lymphatischen Leukämie. Doch nicht jede Behandlung ist für jeden Menschen mit CLL geeignet. Entscheidende Kriterien sind unter anderem die individuelle Verfassung der Betroffenen, eventuelle Vorerkrankungen, bereits durchgeführte Behandlungen und das jeweilige Stadium der CLL.
Für Sie als Patientin oder Patient kommt es daher darauf an, im vertrauensvollen Gespräch zusammen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt zu klären, ob eine Behandlung bereits notwendig ist oder ob die Krankheit zunächst lediglich engmaschig beobachtet werden sollte (die sogenannte „Watch and wait“-Phase“).
Wenn der Beginn einer Therapie aus ärztlicher Sicht nötig ist, ist es für Sie entscheidend, eine Therapie zu finden, die bestmöglich auf Sie und Ihre CLL-Erkrankung zugeschnitten ist.
Leben mit CLL

Leben mit CLL
Begleitend zur ärztlichen Behandlung haben Sie es als Patientin oder Patient zu einem großen Teil selbst in der Hand, Ihr Leben trotz und mit der Diagnose CLL positiv zu gestalten. Sie können aktiv einiges für Ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden tun.
Es geht auf dieser Seite daher nicht nur um die medizinischen und körperlichen Aspekte der Erkrankung CLL: Das Wissen, an einer chronischen lymphatischen Leukämie erkrankt zu sein, kann eine starke Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen darstellen – egal ob sich bereits Symptome gezeigt haben oder nicht. Ängste können auftreten, Konflikte ausgelöst werden.
Das ist verständlich und kein Zeichen von Schwäche. Aus diesem Grund finden Sie auf den folgenden Seiten Tipps und Hilfestellungen, um Ihre Lebensqualität trotz CLL weiter aufrechtzuerhalten und mit Sorgen und Ängsten umzugehen.
Leben mit CLL

Begleitend zur ärztlichen Behandlung haben Sie es als Patientin oder Patient zu einem großen Teil selbst in der Hand, Ihr Leben trotz und mit der Diagnose CLL positiv zu gestalten. Sie können aktiv einiges für Ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden tun.
Es geht auf dieser Seite daher nicht nur um die medizinischen und körperlichen Aspekte der Erkrankung CLL: Das Wissen, an einer chronischen lymphatischen Leukämie erkrankt zu sein, kann eine starke Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen darstellen – egal ob sich bereits Symptome gezeigt haben oder nicht. Ängste können auftreten, Konflikte ausgelöst werden.
Das ist verständlich und kein Zeichen von Schwäche. Aus diesem Grund finden Sie auf den folgenden Seiten Tipps und Hilfestellungen, um Ihre Lebensqualität trotz CLL weiter aufrechtzuerhalten und mit Ihren Sorgen und Ängsten umzugehen.
Fachbegriffe
Medizinersprache: Was will der Arzt mir sagen?
Oft ist die Sprache, in der Ärztinnen und Ärzte die CLL und ihre Therapien erklären, für Laien schwer zu verstehen. Hier finden Sie eine Übersicht über die immer wieder auftretenden medizinischen Fachbegriffe – samt verständlicher Erklärungen.
Wissenstest
CLL: Hätten Sie es gewusst?
Wie viel wissen Sie über die CLL? Kennen Sie sich mit der Erkrankung, ihren Ursachen und Symptomen gut aus? In unseren Wissenstests zu verschiedenen Themenkomplexen können Sie es herausfinden.
Videos

Geschichten von Betroffenen
Die Diagnose der CLL geht mit starken Emotionen und enormen psychischen Herausforderungen einher. Wie gehen Betroffene am besten damit um und erreichen Akzeptanz für ihre Krankheit?

Psychoonkologische Unterstützung
Videos von Psychoonkologen sollen Ihnen einen tieferen Einblick in den Umgang mit der Erkrankung und zum Leben mit CLL geben.
Kontakt- und Anlaufstellen
Unsere interaktive Karte hilft Ihnen weiterführende Kontakt- und Anlaufstellen in Ihrer Nähe zu finden, die bei einer CLL-Erkrankung hilfreich sein können.
Fragen Sie unsere Expert:innen
Häufig bleiben nach einem Arztbesuch Fragen offen oder Informationen erscheinen widersprüchlich, sodass Patient:innen und Angehörige unsicher sind, welche Antworten und Informationen in ihrer speziellen Situation wichtig und richtig sind.
Sie müssen mit Ihrer Frage nicht bis zum nächsten Arztbesuch warten.